Physiker entwickeln Thermometer zur Messung der „Quanteneigenschaften“
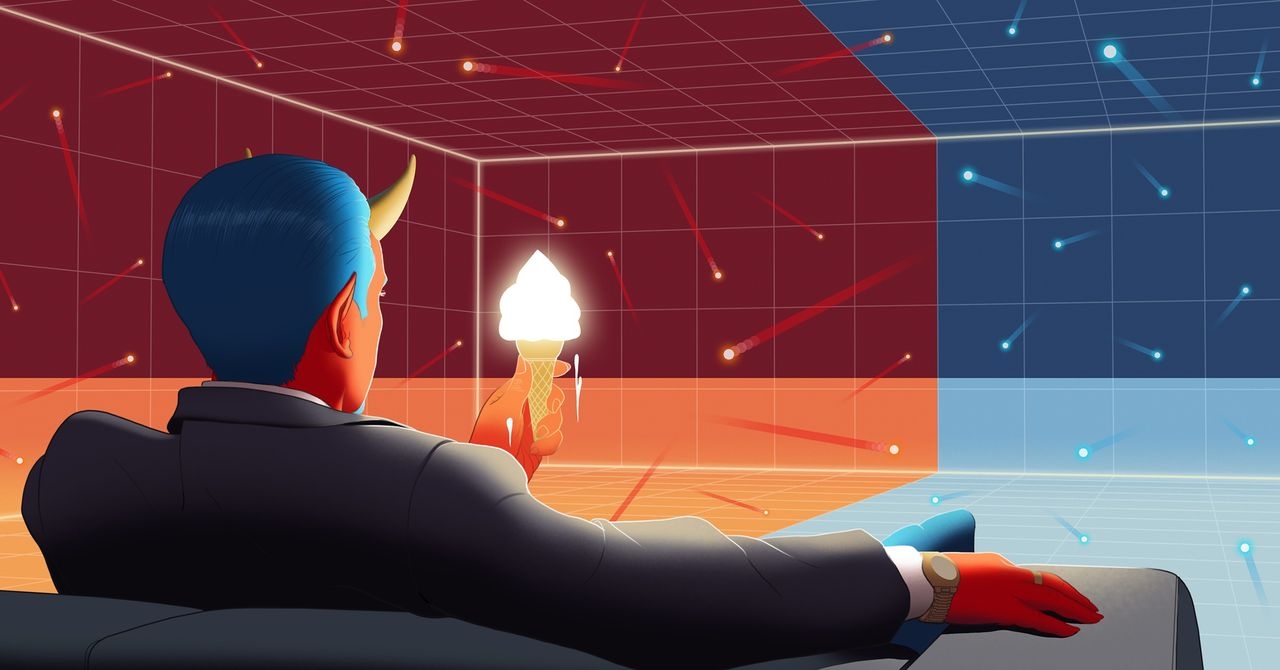
Alle auf WIRED vorgestellten Produkte wurden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von Händlern und/oder für Käufe über diese Links. Mehr erfahren.
Die Originalfassung dieser Geschichte erschien im Quanta Magazine .
Wenn es ein physikalisches Gesetz gibt, das leicht zu verstehen scheint, dann ist es der zweite Hauptsatz der Thermodynamik: Wärme fließt spontan von wärmeren zu kälteren Körpern. Doch nun hat mir Alexssandre de Oliveira Jr. ganz sanft und beinahe beiläufig gezeigt, dass ich ihn überhaupt nicht verstanden habe.
„Nehmen Sie diese heiße Tasse Kaffee und diesen kalten Milchkrug“, sagte der brasilianische Physiker, als wir in einem Café in Kopenhagen saßen. „Bringen Sie sie in Kontakt, und tatsächlich fließt Wärme vom heißen zum kalten Gegenstand, genau wie der deutsche Wissenschaftler Rudolf Clausius es 1850 erstmals formalisiert hat.“ In manchen Fällen, erklärte de Oliveira, hätten Physiker jedoch herausgefunden, dass die Gesetze der Quantenmechanik den Wärmefluss auch in die entgegengesetzte Richtung lenken können: von kalt nach heiß.
Das heißt nicht, dass das zweite Gesetz der Thermodynamik ungültig ist, fügte er hinzu, während sein Kaffee beruhigend abkühlte. Es bedeutet lediglich, dass Clausius' Formulierung die „klassische Grenze“ einer umfassenderen Formulierung darstellt, die die Quantenphysik fordert.
Physiker begannen die Feinheiten dieser Situation vor über zwei Jahrzehnten zu erkennen und erforschen seither die quantenmechanische Version des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Nun haben de Oliveira, Postdoktorand an der Technischen Universität Dänemark, und seine Kollegen gezeigt , dass der auf der Quantenebene mögliche „anomale Wärmefluss“ eine praktische und raffinierte Anwendung finden könnte.
Es kann, so die Forscher, als einfache Methode dienen, um „Quanteneigenschaften“ zu erkennen – beispielsweise, ob sich ein Objekt in einer Quantenüberlagerung mehrerer möglicher beobachtbarer Zustände befindet oder ob zwei solcher Objekte verschränkt sind und ihre Zustände voneinander abhängen –, ohne diese empfindlichen Quantenphänomene zu zerstören. Ein solches Diagnosewerkzeug könnte sicherstellen, dass ein Quantencomputer tatsächlich Quantenressourcen für seine Berechnungen nutzt. Es könnte sogar helfen, Quantenaspekte der Gravitation zu erfassen, eines der ambitionierten Ziele der modernen Physik. Alles, was dazu nötig ist, so die Forscher, ist die Verbindung eines Quantensystems mit einem zweiten System, das Informationen darüber speichern kann, und mit einem Kühlkörper: einem Körper, der viel Energie aufnehmen kann. Mit diesem Aufbau lässt sich die Wärmeübertragung zum Kühlkörper deutlich steigern und über das klassisch Zulässige hinaus erhöhen. Durch einfaches Messen der Temperatur des Kühlkörpers könnte man dann das Vorhandensein von Überlagerung oder Verschränkung im Quantensystem nachweisen.
Abgesehen von den praktischen Vorteilen verdeutlicht die Forschung einen neuen Aspekt einer grundlegenden Wahrheit der Thermodynamik: Die Umwandlung und der Transport von Wärme und Energie in physikalischen Systemen hängen eng mit Information zusammen – mit dem, was über diese Systeme bekannt ist oder bekannt sein kann. In diesem Fall „bezahlen“ wir für den anomalen Wärmefluss, indem wir gespeicherte Informationen über das Quantensystem opfern.
„Ich liebe die Vorstellung, dass thermodynamische Größen auf Quantenphänomene hinweisen können“, sagte die Physikerin Nicole Yunger Halpern von der Universität Maryland. „Das Thema ist fundamental und tiefgründig.“
Wissen ist MachtDer Zusammenhang zwischen dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und Information wurde erstmals im 19. Jahrhundert von dem schottischen Physiker James Clerk Maxwell untersucht. Zu Maxwells Bestürzung schien Clausius’ zweiter Hauptsatz zu implizieren, dass sich Wärmeinseln im gesamten Universum verteilen würden, bis alle Temperaturunterschiede verschwinden. Dabei würde die Gesamtentropie des Universums – vereinfacht gesagt ein Maß für seine Unordnung und Strukturlosigkeit – unaufhaltsam zunehmen. Maxwell erkannte, dass dieser Trend schließlich jede Möglichkeit zunichtemachen würde, Wärmeströme für nützliche Arbeit zu nutzen, und dass das Universum in ein steriles Gleichgewicht verfallen würde, durchdrungen von einem gleichmäßigen Summen thermischer Bewegung: ein „Wärmetod“. Diese Prognose wäre für jeden beunruhigend genug. Für den tiefgläubigen Christen Maxwell war sie ein Gräuel. Doch in einem Brief an seinen Freund Peter Guthrie Tait aus dem Jahr 1867 behauptete Maxwell, einen Weg gefunden zu haben, eine „Lücke“ im zweiten Hauptsatz zu finden.

„Es ist unmöglich für eine sich selbst steuernde Maschine, ohne äußere Einwirkung, Wärme von einem Körper auf einen anderen mit höherer Temperatur zu übertragen“, schrieb Rudolf Clausius im Jahr 1850. Dies war die erste Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik.
Foto: Bettmann/Getty ImagesEr stellte sich ein winziges Wesen vor (später Dämon genannt), das die Bewegungen einzelner Moleküle in einem Gas beobachten konnte. Das Gas füllte einen Kasten, der durch eine Wand mit einer Falltür in zwei Hälften geteilt war. Durch gezieltes Öffnen und Schließen der Falltür konnte der Dämon die sich schneller bewegenden Moleküle in einem Abteil und die sich langsamer bewegenden im anderen einschließen und so ein heißes bzw. ein kaltes Gas erzeugen. Indem er die Informationen über die Molekülbewegungen nutzte, reduzierte der Dämon die Entropie des Gases und erzeugte so einen Temperaturgradienten, der für mechanische Arbeit, wie beispielsweise das Bewegen eines Kolbens, genutzt werden konnte.
Wissenschaftler waren sich sicher, dass Maxwells Dämon den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht verletzen konnte, doch es dauerte fast 100 Jahre, bis sie den Grund dafür herausfanden. Die Antwort liegt darin, dass die Informationen, die der Dämon über die Molekülbewegungen sammelt und speichert, irgendwann seinen endlichen Speicher füllen. Um weiterarbeiten zu können, muss sein Speicher dann gelöscht und zurückgesetzt werden. Der Physiker Rolf Landauer zeigte 1961, dass dieses Löschen Energie verbraucht und Entropie erzeugt – mehr Entropie, als durch die Sortiervorgänge des Dämons reduziert wird. Landauers Analyse etablierte eine Äquivalenz zwischen Information und Entropie und implizierte, dass Information selbst als thermodynamische Ressource dienen kann: Sie kann in Arbeit umgewandelt werden. Physiker demonstrierten diese Umwandlung von Information in Energie experimentell im Jahr 2010.

Verunsichert durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, erfand der schottische Physiker James Clerk Maxwell ein Gedankenexperiment über einen allwissenden Dämon, das auch heute noch Erkenntnisse liefert.
Illustration: The Print Collector/Heritage ImagesDoch Quantenphänomene ermöglichen die Informationsverarbeitung auf eine Weise, die die klassische Physik nicht zulässt – das ist die Grundlage von Technologien wie Quantencomputing und Quantenkryptographie. Und deshalb stellt die Quantentheorie den herkömmlichen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik infrage.
Ausnutzen von KorrelationenVerschränkte Quantenobjekte besitzen gegenseitige Information: Sie sind korreliert, sodass wir Eigenschaften des einen durch die Betrachtung des anderen erkennen können. Das ist an sich nicht ungewöhnlich; betrachtet man einen Handschuh eines Paares und stellt fest, dass er linkshändig ist, weiß man, dass der andere rechtshändig ist. Ein Paar verschränkter Quantenteilchen unterscheidet sich jedoch in einem wichtigen Punkt von Handschuhen: Während die Händigkeit von Handschuhen bereits vor der Betrachtung festgelegt ist, gilt dies laut Quantenmechanik nicht für die Teilchen. Bevor wir sie messen, ist der Wert der beobachtbaren Eigenschaft jedes Teilchens im verschränkten Paar noch nicht bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt kennen wir lediglich die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Wertkombinationen, beispielsweise 50 Prozent links-rechts und 50 Prozent rechts-links. Erst wenn wir den Zustand eines der Teilchen messen, lösen sich diese Möglichkeiten in ein eindeutiges Ergebnis auf. Bei diesem Messvorgang wird die Verschränkung aufgehoben.
Sind Gasteilchen auf diese Weise verschränkt, kann ein Maxwellscher Dämon sie effizienter manipulieren, als wenn sich alle Moleküle unabhängig voneinander bewegen. Weiß der Dämon beispielsweise, dass ein sich schnell bewegendes Molekül, das er kommen sieht, so korreliert ist, dass ihm kurz darauf ein weiteres schnelles Molekül folgt, muss er das zweite Teilchen nicht beobachten, bevor er die Falltür öffnet, um es einzulassen. Die thermodynamischen Kosten für die (vorübergehende) Außerkraftsetzung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik werden dadurch gesenkt.
Im Jahr 2004 wiesen die Quantentheoretiker Časlav Brukner von der Universität Wien und Vlatko Vedral , damals am Imperial College London, darauf hin , dass makroskopische thermodynamische Messungen als „Zeuge“ für die Existenz von Quantenverschränkung zwischen Teilchen dienen können. Unter bestimmten Bedingungen, so zeigten sie, sollte die Wärmekapazität eines Systems oder seine Reaktion auf ein angelegtes Magnetfeld einen Hinweis auf Verschränkung liefern, sofern diese vorhanden ist.
In ähnlicher Weise berechneten andere Physiker, dass man aus einem warmen Körper mehr Arbeit gewinnen kann, wenn Quantenverschränkung im System vorliegt, als wenn es sich um einen rein klassischen Körper handelt.
Und im Jahr 2008 entdeckte der Physiker Hossein Partovi von der California State University eine besonders dramatische Konsequenz der Quantenverschränkung: Sie kann gängige Vorstellungen der klassischen Thermodynamik untergraben. Er erkannte, dass Verschränkung den spontanen Wärmefluss von einem heißen zu einem kalten Objekt umkehren kann und damit scheinbar den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik selbst außer Kraft setzt.
Diese Umkehrung ist eine besondere Art der Kühlung, erklärte Yunger Halpern. Und wie üblich bei Kühlung ist sie nicht kostenlos (und widerspricht somit nicht wirklich dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik). Klassisch betrachtet erfordert das Kühlen eines Objekts Arbeit: Wir müssen die Wärme in die „falsche“ Richtung transportieren, indem wir Brennstoff verbrauchen und so die Entropie ausgleichen, die durch die weitere Kühlung des kalten und die Erwärmung des heißen Objekts verloren geht. Im Quantenfall hingegen, so Yunger Halpern, werden zur Kühlung nicht Brennstoffe, sondern Korrelationen verbraucht. Anders ausgedrückt: Mit fortschreitendem anomalen Wärmefluss wird die Verschränkung zerstört: Teilchen, die ursprünglich korrelierte Eigenschaften besaßen, werden unabhängig. „Wir können die Korrelationen als Ressource nutzen, um Wärme in die entgegengesetzte Richtung zu leiten“, sagte Yunger Halpern.

Vlatko Vedral ist einer der Urheber der Idee, thermodynamische Messungen als „Zeuge“ zu verwenden, um das Vorhandensein von Quantenverschränkung zwischen Teilchen nachzuweisen.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Vlatko VedralIm Grunde genommen ist der Treibstoff hier die Information selbst: genauer gesagt die gegenseitige Information der verschränkten heißen und kalten Körper.
Zwei Jahre später brachten David Jennings und Terry Rudolph vom Imperial College London Klarheit in diese Thematik. Sie zeigten, wie der zweite Hauptsatz der Thermodynamik so umformuliert werden kann, dass er auch den Fall gegenseitiger Information berücksichtigt, und berechneten die Grenzen, inwieweit der klassische Wärmefluss durch den Verbrauch von Quantenkorrelationen verändert und sogar umgekehrt werden kann.
Der Dämon weiß es.Wenn Quanteneffekte eine Rolle spielen, ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht mehr so einfach. Aber lässt sich die Art und Weise, wie die Quantenphysik die Grenzen der thermodynamischen Gesetze erweitert, sinnvoll nutzen? Das ist eines der Ziele der Quantenthermodynamik, in der einige Forscher versuchen, Quantenmotoren zu entwickeln, die effizienter arbeiten als klassische, oder Quantenbatterien, die sich schneller aufladen lassen.
Patryk Lipka-Bartosik vom Zentrum für Theoretische Physik der Polnischen Akademie der Wissenschaften verfolgte einen anderen Ansatz: die Thermodynamik als Werkzeug zur Erforschung der Quantenphysik zu nutzen. Letztes Jahr gelang es ihm und seinen Mitarbeitern, die Idee von Brukner und Vedral aus dem Jahr 2004 umzusetzen , thermodynamische Eigenschaften als Indiz für Quantenverschränkung zu verwenden. Ihr Schema beinhaltet heiße und kalte Quantensysteme, die miteinander korreliert sind, sowie ein drittes System, das den Wärmefluss zwischen den beiden vermittelt. Dieses dritte System kann man sich als Maxwellschen Dämon vorstellen, der nun über ein „Quantengedächtnis“ verfügt, das selbst mit den von ihm manipulierten Systemen verschränkt werden kann. Durch die Verschränkung mit dem Gedächtnis des Dämons werden die heißen und kalten Systeme effektiv miteinander verbunden, sodass der Dämon aus den Eigenschaften des einen Systems Rückschlüsse auf das andere ziehen kann.

Patryk Lipka-Bartosik hat erforscht, wie man thermodynamische Messungen zur Erkennung von Quanteneffekten nutzen kann.
Foto: Alicja Lipka-BartosikEin solcher Quantendämon kann als eine Art Katalysator wirken und den Wärmetransfer fördern, indem er auf Korrelationen zugreift, die sonst unzugänglich wären. Da er mit den heißen und kalten Objekten verschränkt ist, kann der Dämon systematisch alle ihre Korrelationen erfassen und nutzen. Und wiederum wie ein Katalysator kehrt dieses dritte System in seinen ursprünglichen Zustand zurück, sobald der Wärmeaustausch zwischen den Objekten abgeschlossen ist. Auf diese Weise kann der Prozess den anomalen Wärmefluss über das hinaus steigern, was ohne einen solchen Katalysator möglich wäre.
Die diesjährige Arbeit von de Oliveira, die er gemeinsam mit Lipka-Bartosik und Jonatan Bohr Brask von der Technischen Universität Dänemark verfasste, greift einige dieser Ideen auf, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Die Anordnung wird dadurch zu einer Art Thermometer zur Messung von Quanteneigenschaften. In der früheren Arbeit interagierte der dämonenartige Quantenspeicher mit einem korrelierten Paar von Quantensystemen, einem heißen und einem kalten. In der aktuellen Arbeit befindet er sich hingegen zwischen einem Quantensystem (beispielsweise einem Array verschränkter Quantenbits, kurz Qubits, in einem Quantencomputer) und einem einfachen Kühlkörper, mit dem das Quantensystem nicht direkt verschränkt ist.
Da der Speicher sowohl mit dem Quantensystem als auch mit der Wärmesenke verschränkt ist, kann er erneut einen Wärmefluss zwischen ihnen auslösen, der über das klassisch Mögliche hinausgeht. Dabei wird die Verschränkung innerhalb des Quantensystems in zusätzliche Wärme umgewandelt, die in die Wärmesenke gelangt. Die Messung der in der Wärmesenke gespeicherten Energie (vergleichbar mit der Messung ihrer „Temperatur“ ) offenbart somit das Vorhandensein von Verschränkung im Quantensystem. Da System und Wärmesenke selbst jedoch nicht verschränkt sind, beeinflusst die Messung den Zustand des Quantensystems nicht. Dieses Verfahren umgeht die bekannte Tatsache, dass Messungen die Quanteneigenschaften zerstören. „Würde man versuchen, direkt am [Quanten-]System eine Messung durchzuführen, würde man dessen Verschränkung zerstören, bevor der Prozess überhaupt stattfinden kann“, erklärte de Oliveira.

Die Physiker Alexsandre de Oliveira Jr. (links) und Jonatan Bohr Brask (rechts) arbeiteten mit Patryk Lipka-Bartosik an einem neuen Schema zum Nachweis von Quanteneigenschaften, ohne diese zu zerstören.
Foto: Jonas Schou Neergaard-NielsenDas neue Verfahren zeichnet sich durch seine Einfachheit und Allgemeingültigkeit aus, so Vedral, der mittlerweile an der Universität Oxford tätig ist. „Diese Verifizierungsprotokolle sind von entscheidender Bedeutung“, erklärte er. Immer wenn ein Quantencomputer-Unternehmen die Leistung seines neuesten Geräts bekannt gibt, stellt sich die Frage, wie (oder ob überhaupt) sichergestellt werden kann, dass die Verschränkung zwischen den Qubits die Berechnung tatsächlich unterstützt. Ein Kühlkörper könnte allein durch seine Energieänderung als Detektor für solche Quantenphänomene dienen. Zur Umsetzung dieser Idee könnte man ein Quantenbit als Speicher festlegen, dessen Zustand den Zustand anderer Qubits offenbart, und dieses Speicher-Qubit dann mit einer Gruppe von Teilchen koppeln, die als Kühlkörper dienen und deren Energie man messen kann. (Eine Voraussetzung, fügte Vedral hinzu, ist die sehr gute Kontrolle über das System, um sicherzustellen, dass keine anderen Wärmequellen die Messungen verfälschen. Außerdem kann die Methode nicht alle verschränkten Zustände erfassen.)
De Oliveira ist der Ansicht, dass bereits ein System existiert, um ihre Idee experimentell zu testen. Er und seine Kollegen besprechen dieses Ziel mit der Forschungsgruppe von Roberto Serra an der Bundesuniversität ABC in São Paulo, Brasilien. Im Jahr 2016 nutzten Serra und seine Kollegen die magnetische Ausrichtung, den Spin, von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen in Chloroformmolekülen als Quantenbits, zwischen denen sie Wärme übertragen konnten.
Mit diesem Aufbau, so de Oliveira, sollte es möglich sein, ein Quantenverhalten – in diesem Fall Kohärenz, d. h. die phasengleiche Entwicklung der Eigenschaften zweier oder mehrerer Spins – auszunutzen, um den Wärmefluss zwischen den Atomen zu verändern. Die Kohärenz von Qubits ist für das Quantencomputing unerlässlich; daher könnte der Nachweis eines anomalen Wärmeaustauschs hilfreich sein.
Es steht noch viel mehr auf dem Spiel. Mehrere Forschungsgruppen arbeiten an Experimenten, um herauszufinden, ob die Gravitation eine Quantenkraft ist, wie die anderen drei fundamentalen Kräfte. Einige dieser Bemühungen zielen darauf ab, Quantenverschränkung zwischen zwei Objekten zu untersuchen, die allein durch ihre gegenseitige Gravitationsanziehung entsteht. Möglicherweise könnten Forscher diese gravitationsbedingte Verschränkung durch einfache thermodynamische Messungen an den Objekten nachweisen und so bestätigen (oder widerlegen), dass die Gravitation tatsächlich quantisiert ist.
„Wäre es nicht wunderbar, wenn man etwas so Einfaches und Makroskopisches wie dieses tun könnte, um eine der grundlegendsten Fragen der Physik zu untersuchen?“
Der Originalartikel wurde mit freundlicher Genehmigung von Quanta Magazine , einer redaktionell unabhängigen Publikation der Simons Foundation, nachgedruckt . Ziel der Publikation ist es, das öffentliche Verständnis von Wissenschaft zu verbessern, indem sie über Forschungsentwicklungen und Trends in Mathematik sowie in den physikalischen und Lebenswissenschaften berichtet.
wired




